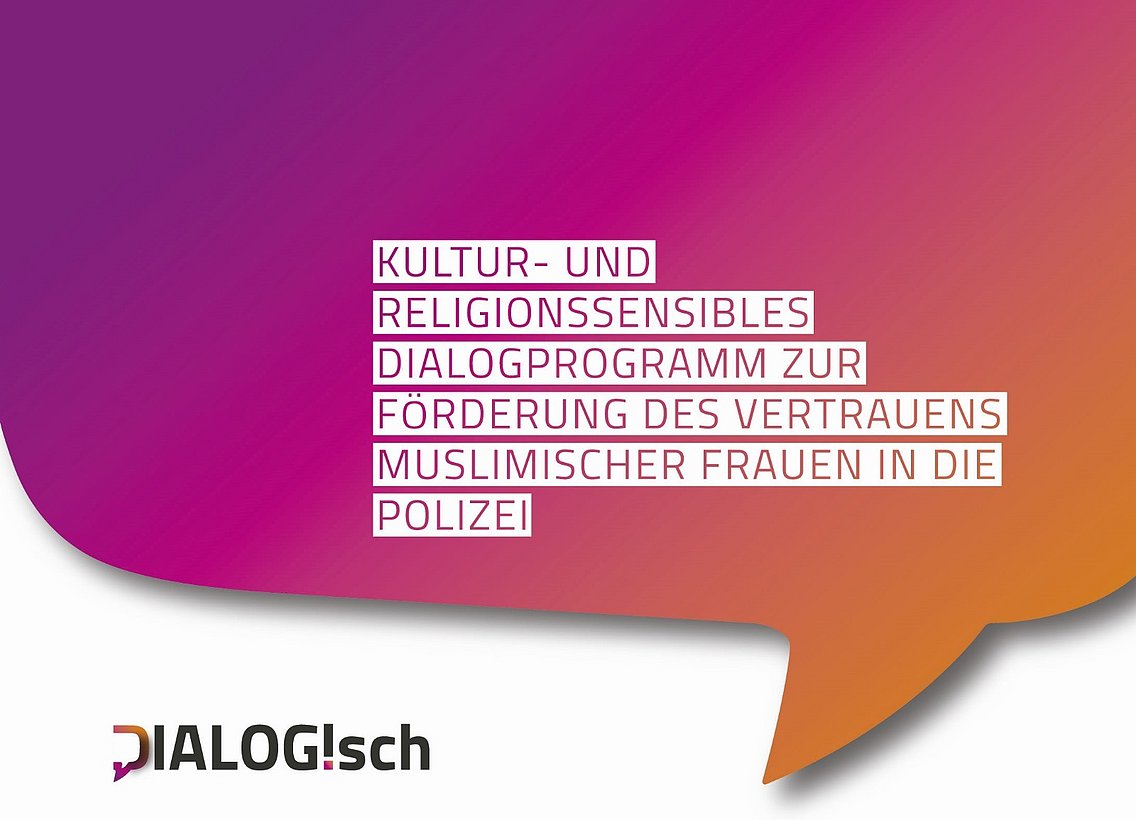Kultur- und religionssensibles Dialogprogramm zur Förderung des Vertrauens muslimischer Frauen in die Polizei (DIALOGisch)
Bei Partnerschaftsgewalt ist die Polizei häufig die erste Instanz, die sich im Rahmen der Krisenintervention um die betroffenen Frauen kümmert. Ein Rückkehrverbot gegenüber dem Täter oder eine Wohnungsverweisung dient (vorerst) der Abwendung der unmittelbaren Gefährdungssituation, noch bevor Kontakt- oder Näherungsverbote durch Gerichte verfügt werden. Oft ist es auch die Polizei, die das Opfer über entsprechende Beratungsangebote vor Ort informiert und Informationsmaterial aushändigt. Allerdings suchen etwa zwei Drittel der weiblichen Betroffenen weder Unterstützung bei der Polizei noch versuchen sie, bei einer Beratungseinrichtung Hilfe zu finden. Unter muslimischen Frauen wird das Dunkelfeld noch höher eingeschätzt. Internationale Studien zu Partnerschaftsgewalt und den Barrieren in das Hilfesystem identifizieren vor allem den wahrgenommenen institutionellen Rassismus und Diskriminierungserfahrungen als eine zentrale Hürde der Inanspruchnahme von Hilfe durch Polizei und Beratungseinrichtungen. Das Vertrauen in die Professionalität von Polizei und sozialer Arbeit stellt daher eine wesentliche Voraussetzung für den Meldeprozess sowie die Inanspruchnahme von Maßnahmen des Gewaltschutzes und der daran anschließenden Interventionskette dar.
Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel des Projekts, das Polizeivertrauen unter muslimischen Frauen im Bereich der Partnerschaftsgewalt zu erhöhen. Dazu wird in der Landeshauptstadt Düsseldorf ein kultur- und religionssensibles Dialogprogramm konzipiert und umgesetzt, dessen bedarfsorientierte Entwicklung und Einrichtung wissenschaftlich begleitet und evaluiert wird. Die Projektergebnisse werden in eine strukturierte Arbeitshilfe überführt, die Polizeibehörden bundesweit in die Lage versetzen soll, kultur- und religionssensible Austauschformate zum Thema Partnerschaftsgewalt gezielt und in einem Netzwerk lokaler Einrichtungen und Organisationen umzusetzen.
Selbstverständnis
Das Projekt DIALOGisch richtet sich gezielt an muslimische und muslimisch gelesene Frauen. Die Prävalenz ihrer Gewalterfahrungen unterscheidet sich nicht von der Mehrheitsgesellschaft.1 Internationale Studien zeigen jedoch, dass sie im Kontext partnerschaftlicher Gewalt mit spezifischen Zugangshürden zum Schutz- und Hilfesystem konfrontiert sind.1 Diese resultieren aus Sprachbarrieren und Diskriminierungserfahrungen sowie einem damit verbundenen geringeren Vertrauen in staatliche Institutionen.2,3 Formelle Unterstützungsangebote tragen diesen Barrieren bislang häufig nicht ausreichend Rechnung, wodurch Ausschlüsse produziert und Zugänge zu essenzieller Hilfe erschwert werden. DIALOGisch verfolgt einen bedarfsorientierten Ansatz, der die Perspektiven der Zielgruppe durch wissenschaftliche Erhebungen und aktive Einbindung systematisch einbezieht. Dabei berücksichtigt das Projekt bewusst die Diversität der Zielgruppe, die durch unterschiedliche religiöse Strömungen, kulturelle Hintergründe und Lebensrealitäten geprägt ist. Ziel ist es, die Chancengleichheit im Zugang zu Schutz- und Hilfemaßnahmen zu verbessern, kultur- und religionssensible Lösungsansätze zu entwickeln und zugleich Polizeibeamt*innen für die spezifischen Bedarfe der Zielgruppe zu sensibilisieren.
1 Istratii, R., Ali, P., & Feder, G. (2024). Integration of religious beliefs and faith-based resources in domestic violence services to migrant and ethnic minority communities: A scoping review. Violence: An International Journal, 5(1), 94–122. https://doi.org/10.1177/26330024241246810
2 Hulley, J., Bailey, L., Kirkman, G., Gibbs, G. R., Gomersall, T., Latif, A., & Jones, A. (2023). Intimate partner violence and barriers to help-seeking among Black, Asian, minority ethnic and immigrant women: A qualitative metasynthesis of global research. Trauma, Violence, & Abuse, 24(2), 1001–1015. https://doi.org/10.1177/15248380211050590
3 Wright, S. E. (2022). Navigating the disjuncture between domestic and family violence systems: Australian Muslim women’s challenges when disclosing violence. Australian Feminist Law Journal, 48(2), 321–347. https://doi.org/10.1080/13200968.2023.2170893
Projektverantwortung
Telefon: +49 202 439-5603 | Fax: +49 202 439-5601
E-Mail: fiedrich[at]uni-wuppertal.de
Bergische Universität Wuppertal
Fakultät für Maschinenbau und Sicherheitstechnik,
Fachgebiet für Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektsicherheit
Telefon: +49 (0) 202 439-5603
E-Mail: lukas[at]uni-wuppertal.de
Telefon: +49 (0) 202 439-5607
E-Mail: oppers[at]uni-wuppertal.de
Bergische Universität Wuppertal
Fakultät für Maschinenbau und Sicherheitstechnik,
Fachgebiet für Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektsicherheit